| Startseite |
| 1.2.5. Die Feuerwaffen |
| Findige Tüftler, wahrscheinlich aus dem Uhrmacherhandwerk, ersannen schließlich zwischen 1620 und 1640 in Frankreich oder Deutschland den Radschloßmechanismus, auch Flint- und Batterieschloß genannt. Dieser ähnelt dem Mechanismus eines einfachen Feuerzeugs. Durch Drehen eines Schlüssels wird der Radschloßmechanismus über eine Feder aufgezogen. Beim Betätigen des Abzugs entspannt sich die Spiralfeder, wodurch sich ein stählernes, geriffeltes Rad dreht. An dieses Rad wird über einen Federmechanismus eine Hund genannte Halterung gedrückt, die der Serpentine ähnelt, aber in ihrer Funktion einer Schraubzwinge gleicht. Zwischen den Backen des Hundes ist ein Zündstein aus Schwefelkies eingeklemmt, der, an das Rad gedrückt, nun wie bei einem Feuerzeug Funken sprüht, wodurch das Pulver in der Zündpfanne zündet, und schließlich auch der Schuß ausgelöst wird. | 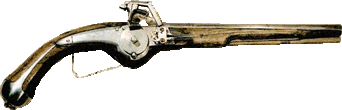 |
| Das Radschloßgewehr und auch die
Radschloßpistole waren auf diese Weise sehr einfach zu bedienen und
auch leichter. Ein Haken zum Auflegen war bei diesen leichteren Waffen
nicht mehr nötig. Zudem konnte (z.B. bei Reisen) der Mechanismus schon
vorher aufgezogen werden, und die Waffe war damit ständig schußbereit. Allerdings war der Mechanismus für die damalige Zeit sehr kompliziert und konnte nur von speziellen Handwerkern (z.B. einem Uhrmacher wieder repariert werden, während ein Luntenschloßgewehr auch von einem einfachen Dorfschmied wieder gangbar gemacht werden konnte. Dies machte die Radschloßwaffen zu sehr teuren Waffen, die sich nur wohlhabendere Leute wie Kaufleute oder Adelige leisten konnten, während Luntenschloßgewehre die Hauptbewaffnung der Soldaten blieben. Das Radschloßgewehr oder Steinschloßgewehr entspricht einer Muskete mit einem Radschloßmechanismus. Dieser vereinfacht die Bedienung des Gewehrs sehr. Verliert man aber im Kampf den Schlüssel für das Radschloß, dann kann die Waffe nur noch als Knüppel eingesetzt werden. Reichweite und Schaden sind gleich dem eines normalen Luntenschloßgewehres guter Machart. Eine Radschloßflinte zu laden, dauert mindestens eine halbe Minute, und man benötigt ca. 10 g grobes und 1 g feines Schießpulver. Mit den Radschloßwaffen ging das Schießen schneller und sicherer. Ob sich ein Schuß lösen würde, war nicht mehr so sehr vom Wetter abhängig. Regnen durfte es allerdings immer noch nicht. Als bevorzugte Waffe von Kaufleuten und Adeligen ist die Radschloßpistole meist reich mit Messingbeschlägen verziert oder sogar vergoldet. Da der Mechanismus ohnehin schon sehr teuer ist, kommt es darauf schließlich auch nicht mehr an. Ist das Radschloß einmal gespannt, so kann die Waffe schußbereit aufbewahrt werden. Eine gute Radschloßpistole hat auch eine einfache Sicherung, um ungewolltes Auslösen durch Erschütterung zu verhindern. Die Radschloßpistole kann zudem auch von einem Reiter benutzt werden. Nachladen kann er aber nur, wenn das Pferd stillsteht. Zum Laden einer Radschloßpistole benötigt man ca. 4 g grobes und 1 g feines Schießpulver. Zur Standardausrüstung eines Schützen gehörten zur damaligen Zeit, neben der Waffe auch Pulverhorn, Ladestock, Kugelbeutel und Pfropfen (aus Papier oder Werg). Zuerst wurde die Zündpfanne mit feinem Pulver gefüllt, dann das Gewehr selbst mit etwas gröberem. Dazu wurde der Lauf von vorne mit dem Pulver gefüllt und mit dem Ladestock verdichtet, der bei moderneren Gewehren praktischerweise in einer Art Scheide im Schaft unter dem Lauf aufbewahrt wurde. Darauf folgte die Kugel, und der Pfropfen verschloß das Ganze und hielt die Kugel im Lauf fest. Hatte man schlechtes Pulver, so mußte man eine entsprechend größere Menge nehmen, und eine kleinere Waffe war dann fast bis zur Mündung gefüllt. Überhaupt kam es sehr auf das Schwarzpulver an. Es durfte, mit Ausnahme für das Zündpulver in der Pfanne, nicht zu fein sein, sonst nahm es Feuchtigkeit an und brannte nur noch ab, ohne zu explodieren. Die Kugeln wurden meist vom Schützen selbst, mit Hilfe einer Form, aus Blei gegossen. Der Karabiner (Stutzen) (engl.: Carabine) Der Karabiner ist die kurze Version des Gewehrs bzw. einer Weiterentwicklung der Hakenbüchse mit Radschloß, für den Gebrauch von Kavalleristen, speziell Dragonern (mit Sattelschuh bzw. Scabbard) und speziellen Infanteristen, den Carabinieri, die diesen Karabiner zusätzlich zu den normalen Nahkampfwaffen am Schulterriemen, dem Bandolier, über den Rücken geschlungen tragen. Der Stutzen ist eine speziell geschäftete Version des Karabiners, wobei der Schaft bis zur Mündung geht und den Lauf dabei vollständig umschließt und schützt. Diese Waffe war z.B. bei Gamsjägern bzw. Gebirgsjägern sehr beliebt, da sie durch die geringe Größe so wenig wie möglich beim Klettern und in unwegsamen Gelände behindert und auch mal einen Stoß vertragen kann, ohne gleich um die Ecke zu schießen. Die Schrotflinte (engl.: Shotgun, franz.: Fusil), auch Stutz- oder Streubüchse genannt, ist eine sehr großkalibrige Waffe, mit der keine Kugel (der Lauf ist zu dünnwandig), sondern nur Schrot verschossen werden kann. Der kleine Holzkolben steht in Diskrepanz zu der sich trichterförmig erweiternden Mündung, die wie die Öffnung einer Posaune aussieht. Diese dient zur Erhöhung der Streuung des Schrots. Mit dieser Waffe werden eine oder mehrere Kugeln im Nahkampf abgefeuert, wenn es nicht auf genaues Zielen und Treffen, sondern auf größere Streuwirkung ankommt. Es gibt sie mit Lunten- oder Radschloßmechanismus, wobei Letzterer teuer und eher ungewöhnlich ist. Das Laden erfordert entsprechend viel Zeit. Für einen Schuß werden 20 g grobes und 2 g feines Schießpulver benötigt. Mit grobem Schrot kann das Gerät selbst einen Bären von den Pfoten blasen. Manche Versionen besitzen zusätzlich noch ein ausklappbares Bajonett am Lauf. In den gesetzlosen Zeiten wurden zahlreiche Feuerwaffen zur Verteidigung gegen bewaffnete Überfälle von Privatleuten hergestellt oder umgebaut. Ein Ehrenmann zu Pferde konnte ein Paar Holsterpistolen am Sattel führen; bei einer Kutschfahrt nahm er vielleicht eine kleine Pistole in der Manteltasche mit. Häufig hatten der Kutscher oder einer der Mitreisenden eine sogenannte Blunderbuss-Flinte in Griffweite. Diese Flinte eignete sich besonders zur Verteidigung auf kurze Distanz; sie wurde auch auf Schiffen eingesetzt. Die breite Mündung half, den Gegner abzuschrecken, und wenn dies nicht gelang, gab die Ladung aus zahlreichen Bleikugeln selbst nervösen Schützen die Chance, ihr Ziel zu treffen. Blunderbuss-Flinten besaßen häufig Bajonette als zusätzlichen Schutz, und der Kolben konnte als Keule benutzt werden. Natürlich eigneten sich diese Steinschloßwaffen genauso gut dazu, den finsteren Absichten des Räubers Nachdruck zu verleihen. Diese Waffen feuern eine Ladung kleiner Schrotkugeln ab und haben nur eine kurze Reichweite. Für einen Schuß werden 15 g grobes und 2 g feines Schießpulver benötigt. Die Flinte aus dem späten 18. Jahrhundert besitzt ein federnd gelagertes Bajonett, das, sobald eine Sperre gelöst wird, nach vorn klappt und einrastet. Das Granatwerfergewehr ist eine beeindruckend massive Waffe, deren Zweck darin besteht, die Reichweite der Granaten zu erhöhen. Es tauchte zum erstenmal im 16. Jahrhundert auf. Es ist ein großkalibriges Steinschloßgewehr, dessen Ladung ausreicht, um eine Granate weit fortzuschleudern. Vorn verbreitert sich der Lauf zu einem Topf, in den die Granate gestopft wird. Vor dem Schuß muß die Lunte der Granate in Brand gesteckt werden. Jede Fehlkalkulation in bezug auf das Entzünden der Granatlunte kann zu tödlichen Verletzungen des Grenadiers und aller Umstehenden führen. Die Waffe ist schon im ungeladenen Zustand enorm schwer (5 Kilogramm). Für einen Schuß werden 30 g grobes und 2 g feines Schießpulver benötigt. Geladen wiegt sie gut 6,5 Kilogramm und entwickelt einen mörderischen Rückstoß. Die kurzen Schlagwaffen des 16. Jahrhunderts waren auch die beliebtesten Objekte für die Konstruktion von Kombinationswaffen. Feuerwaffen wurden mit allen möglichen Blank-, Schlag oder Stangenwaffen zu einer neuen, vielseitigen Waffe verbunden. Reiterhämmer und -äxte waren aber durch ihre Konstruktion und durch ihren Charakter prädestiniert für diese Spielereien. Der eiserne Schaft wurde einfach in das Laufrohr umgebildet und der ohnehin verdickte Handgriff verbarg den Schloß- und Abzugsmechanisinus. Solche ausgefallenen Waffen waren sehr teuer und so war es kein Wunder, daß ausgerechnet die Waffen der Anführer und Befehlshaber zu Kombinationswaffen ausgebaut wurden. Über den Gebrauchswert solcher Waffen kann man streiten. Natürlich konnte die Kugel im Kampf einen Vorteil bedeuten, aber der Aufzugsmechanismus der Radschlösser, die meist in solchen Waffen verbaut wurden, war derart aufwendig, daß er im Kampfgetümmel praktisch gar nicht aufgezogen werden konnte oder der Überraschungsfaktor verloren ging. Läßt man diesen Faktor außer Acht, gab es keinen guten Grund, den Schaft der Waffe durch einen Lauf zu schwächen und nicht einfach eine Pistole an den Sattel zu hängen. Kombinationswaffen drücken vielmehr die Lust am Außergewöhnlichen, am technisch Machbaren der Renaissance und des Manierismus aus. Auf die verschiedenen Varianten von Kombinationswaffen soll hier im einzelnen nicht näher eingegangen werden. Wie man sich leicht denken kann, helfen Rüstungen gegen Feuerwaffen nicht besonders und erweisen sich beim Laden eher als hinderlich, weshalb man auch nach dem Auftauchen der Feuerwaffen in den folgenden Jahrhunderten von massiven Rüstungen abkam. Da der Schuß einer Kanone, einer Lunten- oder Radschloßwaffe verzögert losgeht (das Feuer muß sich erst seinen Weg durch das Pulver von der Zündpfanne bis zur eigentlichen Ladung fressen), kann jemand, der das Aulösen der Waffe registriert, der Schußrichtung ausweichen. Der Kugel selbst kann natürlich nicht ausgewichen werden. Der richtige Umgang mit Feuerwaffen muß erst erlernt werden. Im Gegensatz zum Bogenschießen oder Speerwerfen geht dies jedoch einfacher, da man eigentlich nur zielen können und nicht erst einen komplexen Bewegungsablauf erlernen muß. Lange Zeit waren in der Geschichte sowohl Schwert und Bogen als auch Feuerwaffen gleichzeitig in Gebrauch. Dies lag an der Unsicherheit der ersten Feuerwaffen und der langwierigen Prozedur, um sie nachladen zu können. So wurden Pistolen lange Zeit nur von reichen Reisenden getragen, die sich sonst kaum gegen Banditen und wilde Tiere wehren konnten. Nicht jeder war ein ausgezeichneter Schwertkämpfer, und noch weniger konnten mit dem Bogen umgehen. Zudem waren die Schußwaffen, vor allem die Radschloßwaffen, sehr teuer, und auch Pulver und Kugeln belasteten den Geldbeutel. Verzierte Pistolen wurden so zum Statussymbol der Reichen. Erst später, nachdem einige Erfindungen die Feuerwaffen verbesserten, waren sie Schwert und Bogen überlegen und konnten diese verdrängen. Um 1700 hatten alle europäischen Heere das Steinschloßgewehr übernommen. Die Schußweite betrug etwa 200 Meter. Der Flintstein, ein Feuerstein aus Schwefelkies, mußte nach 30 Schuß ausgewechselt werden. Er war in die Schraubklemme des Hahns geklemmt. Die Klemmen waren häufig mit Leder ausgeschlagen, damit der vorstehende Feuerstein nicht verrutschte. Zog man am Abzug, wurden Sperre und Feder gelöst. Der Hahn schlug auf die Batterie nieder. Diese wiederum diente als Deckel für die Pfanne und schützte in geschlossenem Zustand das Zündpulver vor dem Herausfallen und einigermaßen vor Feuchtigkeit. Der Hahn mit dem vorstehenden Flintstein fiel gegen die Batterie, schlug sie auf, die entstehenden Funken entzündeten das Zündpulver und dieses die Ladung im Lauf. Das Laden erfolgte wie beim Luntengewehr. Die Artillerie erfuhr keine grundlegende Umwandlung. Doch durch die Änderungen von Details wurde auch hier manches verbessert. Zuerst ging es um die Beweglichkeit. Die moderne Bewegungstaktik machte schnelle Positionswechsel der Artillerie notwendig. Geschütze, die im Galopp durchs Gelände gezogen wurden, mußten gezwungenermaßen solide und leichte, voneinander getrennte Räder haben, und der Schwerpunkt des Geschützes mußte sehr tief liegen. Man unterschied zwei Arten der Artillerie: die leichte oder Feldartillerie und die schwere Artillerie für Festungen und Belagerungen. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurde das Problem der übermäßig vielen Kalibermaße gelöst, die dem Artilleristen ziemliches Kopfzerbrechen bereiteten, wenn er sich Munition besorgen mußte. Man reduzierte sie auf wenige gängige Maße. Die Geschosse paßten ziemlich genau. Weder fielen sie durch den Lauf, noch mußte man sie hineinpressen. Man entwarf ein einziges Modell einer Lafette, für die man dann Ersatzteile im Feld mitführte. Durch eine Spindel wurde das Geschütz gehoben und gesenkt und damit die Schußentfernung reguliert. Die seitliche Ausrichtung erfolgte durch Schwenken der Lafette. Oben waren zwei Griffe angebracht, um das Rohr abheben zu können. Mit einiger Treffgenauigkeit schoß man auf 600 bis 800 Meter. Das Steinschloß wurde bis zur Einführung des Perkussionsgewehrs (mit Zündhütchen) verwendet, also bis in die 40er Jahre des 19. Jahrhunderts. Nach dem Siebenjährigen Krieg wurde das Steinschloßgewehr durch das konische Zündioch verbessert, welches das Aufschütten von Zündpulver auf die Pfanne unnötig machte, weil nun ein Teil der Treibladung durch das Zündloch auf die Pfanne lief. Außerdem wurde ein verbesserter stabiler Ladestock entwickelt. Eine Haubitze nannte man eine Kanone, die ihre Geschosse nicht so weit, aber in flacherer Flugbahn gegen den Feind schleuderte. Das Kaliber lag bei 15 cm. Geladen wurden alle diese Geschütze von vorn. Die Pulverladung wurde mit einem Ladestock eingeführt, die Kugel nachgeschoben und das zuvor ins Zündloch geschüttete Pulver entzündet. Das genaue Gegenteil ist der Mörser mit großkalibrigem, kurzem Rohr, ein Steilfeuergeschütz mit geringerer Reichweite für den Festungskrieg. Die üblichen Kaliber maßen zwischen 20 und 30 cm. Dieses Belagerungsgeschütz war gewöhnlich nicht auf eine Räderlafette montiert. Man verschoß nicht nur Granaten, Hohlgeschosse mit Pulverfüllung, die durch eine brennende Lunte kurz vor oder nach dem Auftreffen entzündet wurden und explodierten. Die "Grenadiere" warfen solche kleinen "Handgranaten" auch auf kurze Distanz gegen den Feind. Um größere Reichweiten zu erzielen, wurden spezielle Granatwerfer-Gewehre im 18. Jahrhundert entwickelt. In einer Konvention am 11.12.1868 in Petersburg (Petersburger Deklaration über die Verwendung von Explosivgeschossen) wurden Granatgewehre für Sprengstoffe untersagt. Schießpulver kann man übrigens leicht unbrauchbar machen, indem man es mit Wasser übergießt. Der Salpeter löst sich auf, und der Sauerstoffträger fehlt. |
| © 1999 - 2007 by SilentShadow - Version: 11.01.2007 - zurück zur Startseite |